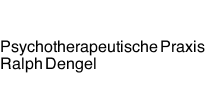Die Gehirnentwicklung im Lichte der Bindungsforschung
Die neurobiologische Forschung der letzten Jahrzehnte hat eine alte psychotherapeutische Grundannahme bestätigt, nämlich die prägende Bedeutung der frühkindlichen Entwicklung, also der Eltern-Kind-Beziehung, für die spätere psychische Verfassung eines Menschen. Nach unserem heutigen Verständnis liegen die Entstehungsbedingungen und Ursachen für eine psychische Erkrankung in der Kindheit.
Betrachten wir ein Beispiel: Etwa 40% der erwachsenen Menschen, denen ein traumatisierendes Ereignis widerfährt, entwickeln danach eine posttraumatische Belastungsstörung. Warum sind es nur 40%, warum erkranken nicht alle Menschen? Schließlich ist doch das traumatische Ereignis das Hauptdiagnosekriterium für eine posttraumatische Belastungsstörung. Ob ein Mensch diese psychische Erkrankung bekommt oder nicht, hängt ab von seiner Widerstandsfähigkeit (der „Resilienz“), die er mitbringt. Als Mensch haben wir eine gewisse innere Verfassung, eine Struktur, die bestimmt, wie belastbar wir sind. Diese Struktur wird durch unsere Biographie gebildet, insbesondere durch die frühen Beziehungserfahrungen, und zwar am stärksten in der Zeit, in der wir am verletzlichsten sind, also in der frühen Kindheit. Die Resilienzforschung verdeutlicht: es ist nicht das Trauma, das die Störung verursacht. Das Trauma ist „nur“ ein Co-Faktor; kommt es zu einer Erkrankung, ist das Trauma der Auslöser, aber nicht die Ursache.
Warum ist die frühe Kindheit von so großer Bedeutung und wie bildet sich die Widerstandsfähigkeit eines Menschen heraus? Der Säugling hat die größtmögliche Abhängigkeit von seinen Bezugspersonen. Wegen dieser Ohnmacht und Abhängigkeit braucht er Bindungssicherheit zu den Eltern. Diese wird dadurch entwickelt, dass das Kind, wenn es Angst hat oder es ihm nicht gut geht, von den Eltern beruhigt oder getröstet wird. Es muss also eine äußere Beruhigungsinstanz verlässlich für das Kind da sein. Ist diese Verlässlichkeit nicht in ausreichendem Maße gegeben, entsteht beim Kind eine „physiologische Wunde“, die es ihm später schwerer machen wird, sich selbst zu beruhigen. Menschen mit einer solchen somatischen Wunde (man könnte auch von einer „Hardwarestörung“ sprechen) haben im späteren Leben oft eine schlechtere Herzvariabilität. Es fällt ihnen dann beispielsweise schwerer, aus einem stressbedingten vegetativen Erregungszustand wieder in einen Zustand der Entspannung zu wechseln, also ihre Herzfrequenz herunterzuregulieren.
Was passiert durch die Beziehungserfahrungen in den ersten zwei Jahren? Im menschlichen Gehirn gibt es einerseits Zentren, die für die Emotionen zuständig sind: Das sogenannte lymbische System setzt sich zusammen aus der Amygdala, dem Angstzentrum, und dem Nucleus Acumbens, der für die Verarbeitung lustvollen Erlebens zuständig ist. Dieser Bereich des Gehirns ist evolutionsgeschichtlich viel älter als der Neocortex, der Sitz von Sprache, Moral, rationalem analytischem Denken, Selbstreflektion und bewusster Handlungsplanung. Wenn wir auf die Welt kommen, sind wir in den emotionalen Zentren bereits vorinstalliert. Das ist deshalb notwendig, weil wir über die Emotionen mit unserer Umwelt kommunizieren, schließlich können wir uns noch nicht über Sprache mitteilen! Angstvolles Schreien oder Weinen des Säuglings signalisiert: „Es geht mir nicht gut, ich brauche Hilfe, Schutz, Zuwendung“; freudiges Lächeln (etwa wenn die Eltern mit dem Kind spielen): „Das tut mir gut, bereitet mir Lust, bitte weitermachen!“
Während bei unserer Geburt hinsichtlich der emotionalen Netzwerke in unserem Gehirn alles, was wir brauchen, schon da ist, werden die entscheidenden neuronalen Strukturen (also die „Hardware“) in den neocorticalen Bereichen erst nach der Geburt ausgebildet. Diese Strukturen sind wichtig für die bewusste Selbstwahrnehmung, die Weltwahrnehmung und die Selbstregulation. Bei diesen Entwicklungsprozessen spielen nun die Bindungserfahrungen der frühen Zeit eine entscheidende Rolle.
Betrachten wir ein Beispiel: Das Erlernen der Bewegungskoordination, die es uns das Gehen ermöglicht, ist ein langwieriger, schwieriger Prozess. Steht ein Kind zum ersten Mal auf den Beinen, wird es vermutlich Stolz und Freude spüren. Macht es jedoch den ersten Schritt und fällt zu Boden, weint es. Als Kind sind wir „zerrissen“ in solche Teilzustände: in einem Moment sind wir bestens gelaunt, im nächsten tief verzweifelt. Die Erlebniszustände, die das Kind erfährt, sind noch nicht „gepuffert“ durch Bewusstsein denn es kann sein Erleben noch nicht reflektieren; es kann noch keine Distanz aufbauen zu seinem Empfinden, indem es mit sich spricht, sein Erleben in Worte fasst, Dinge in Beziehung setzt, sich von außen betrachtet. Eben deshalb finden die traumatisierendsten Erfahrungen in der Kindheit statt: wir können die Dinge noch nicht benennen, haben keine Begriffe für das, was wir erleben, sind den Geschehnissen wehrlos ausgeliefert. Erst durch diese Distanzierungsleistung des Denkens, Reflektierens und Sprechens (was ein neocorticaler Vorgang ist) kann ein kohärentes Selbstempfinden entstehen. Wenn das Kind sich sagen könnte: „Ich bin gerade zum ersten Mal in meinem Leben auf zwei Beinen gestanden, nun habe ich den ersten Schritt gemacht und da ist es doch klar, dass ich stolpere und hinfalle! Aber ich werde wieder aufstehen und weiter üben und irgendwann kann ich dann gehen wie alle anderen auch – nur Mut!“, dann müsste es nicht traurig sein. Aber es verfügt noch nicht über diese „digitale“ Erlebnisspur, mit der es sein emotionales Erleben synchronisieren und damit regulieren kann. Diese Fähigkeit muss es über Jahre erst noch aufbauen.
Dieser Prozess vollzieht sich über die Bindung zu den Bezugspersonen, die das Kind in einer solchen Situation begleiten, es beruhigen, trösten und mit ihm sprechen. Beispielsweise kann eine Mutter, deren Kind hingefallen ist, „zum einen das Kind auf den Arm nehmen, was einen Perspektivwechsel bewirkt. Zum anderen wird sie das Kind verbal und durch körperliche Berührungen trösten, was einen Fokuswechsel und eine positive Schemaaktivierung bewirkt, die mit dem Gefühl von Ohnmacht und Hilflosigkeit inkompatibel ist. In einem dritten Schritt wird sie mit dem Kind zusammen auf die Kante schauen, um damit einen Ursachenzusammenhang für den Sturz abzuleiten (Regelextraktion). Dieser Ursachenzusammenhang erleichtert dem Kind, sein Hilflosigkeitserleben zu relativieren und einzuordnen, um es anschließend loslassen zu können. Dann ist das Kind im vierten Schritt bereit, sich durch die Mutter auf einen harmlosen Stimulus ablenken zu lassen.“ (Roediger, 2010).
Menschen, die als Erwachsene viel Angst erleben, haben vermutlich auch in ihrer frühen Kindheit intensive Angsterfahrungen erlebt (wodurch sich aufgrund von neuronalen Bahnungsprozessen ein Angstschema gebildet hat), die nicht in ausreichendem Maße durch die Bezugspersonen herunterreguliert wurden. Jeder Mensch ist verwundbar und kann, wenn Stressoren nur lange und intensiv genug anhalten, in eine Panikattacke geraten. Entscheidend ist jedoch, wie viele Hilfestellungen wir als Kinder bekommen haben, die uns später eine Stabilisierungsfunktion ermöglichen. Die Eltern als externale Beruhigungsinstanz bauen sich durch ihr Wirken in die sich bildende neuronale Matrix des Kindes hinein und installieren auf diese Weise eine Selbstberuhigungsinstanz.
Panikpatienten sprechen oft gar nicht davon, dass sie Angst haben. Stattdessen beschreiben sie Körperprozesse und -sensationen, die sie nicht einordnen und benennen können, weswegen sie zunächst zum Arzt oder ins Krankenhaus flüchten. Die Tatsache, dass man dieses Erleben „Angst“ nennen kann, ist eine Mentalisierungsleistung, die in diesem Moment nicht erbracht werden kann, weil Erleben und Wort nicht zusammenfinden. Dies verweist auf die vorsprachliche, kindliche, überwältigende Erlebensqualität. Deshalb spricht man im Volksmund davon, sich „kopflos“ zu verhalten. Und in der Tat sind Menschen im Moment der Panik in den neocortikalen Zonen, in denen sie abstraktions- und denkfähig sind, wie ausgeschaltet: Fühlen blockiert Denken! Der entscheidende therapeutische Lernprozess ist in diesem Fall, das Erleben als Angst einzuordnen, zu relativieren und umzubewerten. Sobald klar ist: „Ich bin nicht Angst, ich habe Angst, ich sterbe nicht, ich habe eine Panikattacke! Ich habe im lymbischen System einen Panikanfall, der geht auch wieder vorbei, ist alles nicht so schlimm!“, ist der Schritt in Richtung Heilung gemacht.
Bei Panik, diesem namenlosen Todesangstgefühl, handelt es sich also um neuronale Prozesse, die aus einer Zeit stammen, die noch gar keine Sprachlichkeit kennen und deshalb reine Emotion sind. Der Mensch rutscht zurück in eine kindliche Erlebensqualität (deshalb spricht man in der Schematherapie vom Kindmodus) und das Korrektiv, der gesunde Erwachsene (die corticalen Prozesse, in denen wir Dinge relativieren, einordnen und umbewerten können) ist abgeschaltet. Aufgabe der Therapie ist es, die Instanz des gesunden Erwachsenen zu fördern und zu stärken; sie soll wieder Herr im eigenen Hause werden. Neurophysiologisch ausgedrückt: die Übermacht der emotionalen Hirnbahnen sollen durch die Stärkung der cortikalen Steuerung gehemmt werden.
Bindungsforschung
Die Bindungsqualität zwischen Müttern und Kindern wurde in den 60er und 70er Jahren anhand eines Experiments erforscht. In ihm wird jeweils eine Mutter mit ihrem Kind (dieses ist nicht älter als 18 Monate) in einen Raum mit Spielzeug geführt. Die Mutter wird gebeten, sich auf einen Stuhl zu setzen. Während das Kind zu spielen beginnt, entfernt sich die Mutter für kurze Zeit aus dem Raum, kehrt dann wieder zurück.
Anhand des Verhaltens, das das Kind in dieser Situation zeigt, wurden verschiedene Bindungstypen definiert (zitiert nach Roediger, 2010, S.41):
„Unsicher-vermeidend gebunden: Das Kind weint bei der Trennung nicht, ignoriert den Elternteil beim Wiedersehen und konzentriert sich die ganze Zeit auf sein Spielzeug, ohne dabei Anzeichen von Stress zu zeigen.
Sicher gebunden: Das Kind kann (ausgehend von der Mutter als sicherer Basis) den Raum erkunden und spielen, weint bei der Trennung, freut sich bei der Rückkehr und kann zwischen dem Kontakt zur Mutter und dem Spiel pendeln.
Unsicher-ambivalent gebunden: Das Kind wirkt schon vor der Trennung angespannt und „auf der Hut“, erforscht die Umgebung wenig und hält sich während des ganzen Tests eng an den Elternteil, ohne jedoch in einen konkreten Kontakt zu gehen („Beschattungssyndrom“). Es beruhigt sich nach dem Wiedersehen nicht, zeigt starke Affekte wie Angst oder Wut, bleibt aber auf den Elternteil fixiert und spielt kaum.“
Die Forschungsergebnisse der letzten Jahrzehnte lassen den Schluss zu: Psychische Erkrankungen stehen im Zusammenhang mit problematischen Bindungskonstellationen der frühen Kindheitsjahre. Die daraus erwachsenden Verwundungen können im späteren Leben überdeckt werden durch Bewältigungsstrategien, wie z.B. eine überkompensierende Kontrollhaltung oder selbstverleugnendes Unterordnungsverhalten. Solche starren Verhaltensmuster können eine Stabilisierung ermöglichen. Kommt es zu Erschütterungen im Leben, kann es jedoch passieren, dass die instabile Untergrundebene, z.B. in der Form von Ängsten oder Depressionen, wieder durchbricht.
Roediger, Eckhard: Praxis der Schematherapie. Stuttgart: Schattauer GmbH 2010.